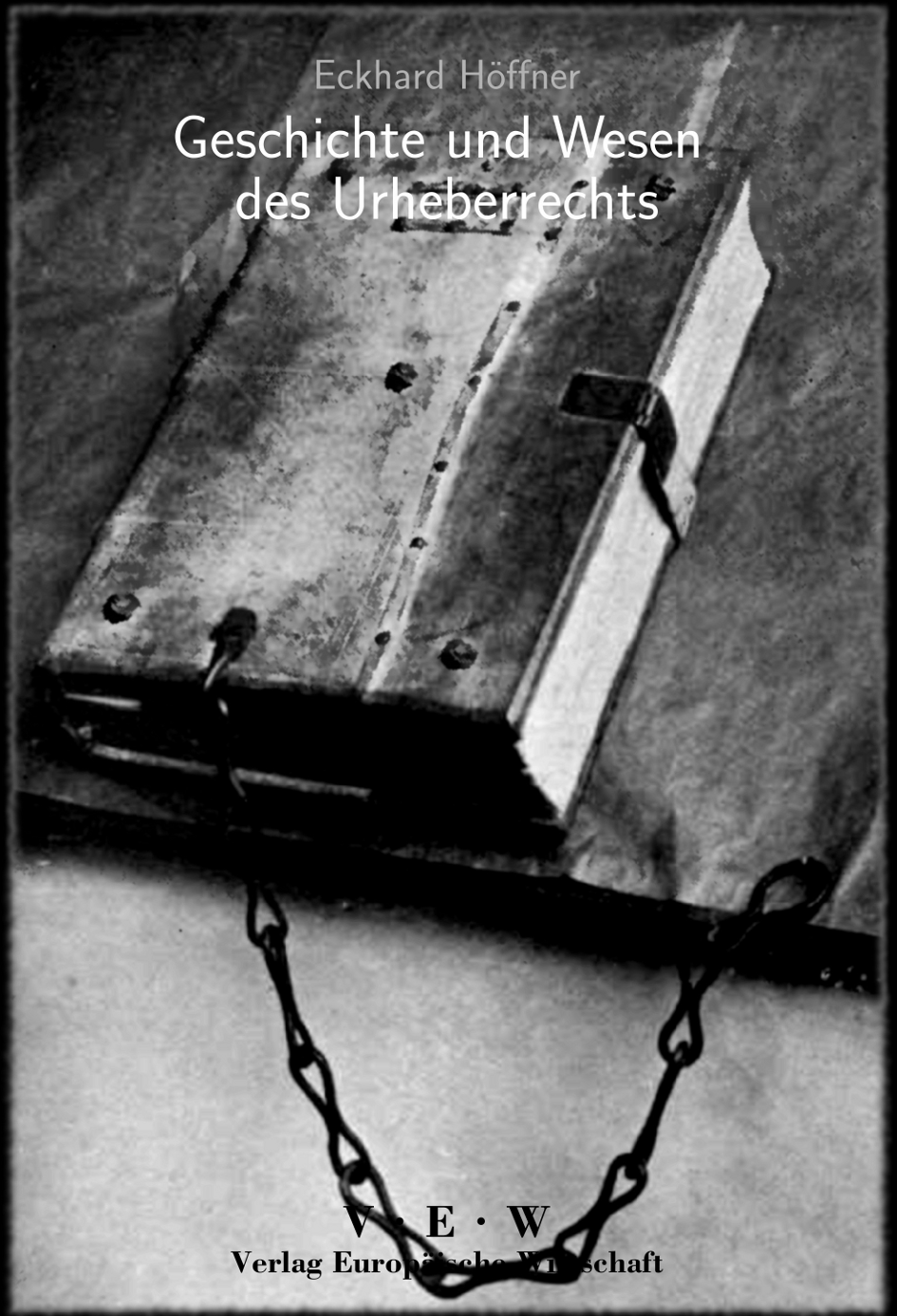Juli 1819 wurden Londons obere Schichte durch das Erscheinen von Don Juan, einem anonym veröffentlichten Versepos, erschüttert. Schon als Sechzehnjähriger verführt Don Juan die verheiratete Donna Julia. Deren naiven Versuche, der Beziehung das körperliche Element zu nehmen, scheitern kläglich. Ihr Ehemann Don Alfonso schöpft Verdacht, durchsucht mit Gehilfen ihr Schlafzimmer, zuerst ohne Erfolg. So blamiert er sich und seine Gattin, doch kaum war die Tür geschlossen und Donna Julia allein im Schlafzimmer: „Vernehmt, was ich so gern verschwiegen hätte: Juan, beinah erstickt, schlüpft‘ aus dem Bette.“ Don Alfonso entdeckt den Jüngling dann doch. Donna Julia kommt in ein Kloster und Don Juan muss Sevilla verlassen und beginnt eine Reise mit Abenteuern und Liebschaften durch halb Europa, eine Mischung aus Candide und James Bond.
Die Anonymität der Veröffentlichung war an sich nicht auffällig, weil der überwiegende Teil der Belletristik in Großbritannien in der dieser Zeit anonym erschien, auch wenn der Text von einem der berühmtesten Autoren Europas, Lord Byron, stammte. Die Liebesabenteuer des Don Juan waren die Grundlage für eine respektlose Satire der Regency Gesellschaft, die die männlichen Phantasien aufs Korn nahm. Es war zugleich ein Angriff auf die Heuchelei, die vorgetäuschte Moral und den schlechten Geschmack der britischen Oberschicht.

Der Prince of Wales und spätere George IV. führte einen ausschweifenden Lebenswandel: Verschwendungs- und Spielsucht, Alkohol, regelmäßige Affären und luxuriöse Paläste — er war trotz hoher Apanage ständig verschuldet. Er war allerdings nicht allein, sondern zugleich Vorbild. Seine Regentschaft gab der Epoche und deren Architektur, Literatur oder Mode den Namen Regency. Der (spätere) König stand über Jahre in engem Kontakt mit einen gesellschaftlichen Zentrum Londons dieser Zeit, dem Beau George Bryan Brummell. Dieser wiederum war vielleicht eine der Inspirationen für den Don Juan von Lord Byron. Zwischen 1799 und 1814 gab es in London kaum eine mondäne gesellschaftliche Veranstaltung, bei der die Anwesenheit des Dandys Brummell nicht als Erfolg, sein Fehlen als Katastrophe angesehen wurde. In den Zeitungsberichten über diese Ereignisse stand sein Name oft an erster Stelle. Er war nicht nur auf Almack’s Bällen (ein Ball war ein nahezu obligates Ereignis in den romantischen Romanen jener Zeit) regelmäßig anzutreffen, sondern genauso in Ascot, Brighton oder dem Watier-Club.
Dandys waren nicht nur für tagtäglich fünfstündige Gardrobe bekannt, sondern auch berüchtigt dafür, dass sie den Ehegatten Hörner aufsetzten und den Frauen gefielen, indem sie ihnen ungefällig waren. Während das Lohnniveau so niedrig war, dass in Arbeiterfamilien nicht nur die Ehefrauen, sondern sogar Kinder unter zehn Jahren oft über zwölf Stunden am Tag arbeiten mussten, entstand in der Oberschicht das Dandytum. Jules Barbey d’Aurevilly (Über das Dandytum und über George Brummell) sagte, das Dandytum zu beschreiben oder zu definieren, sei schwierig. Wer nur das Vordergründige sehe, erkenne nur die Kunst, sich gut anzuziehen, eine Diktatur des Putzes und der äußeren Eleganz. Es sei eine Nuance in zivilisierten Gesellschaften, in denen der Anstand gerade noch über die Langeweile triumphiere. Nirgendwo habe der Antagonismus zwischen dem Anstand und der Langeweile sich in den Sitten so deutlich bemerkbar gemacht wie in England, in der puritanischen Gesellschaft der Bibel und des Rechts.

Für die Damen wurde in dieser Zeit die Unterwäsche, der Petticoat, zu einer Notwendigkeit. Die Stoffe der Oberkleider waren hauchdünn, die Unterröcke aus stabilem Leinen oder aus Baumwolle. Die dekorativen Elemente des Unterrocks lugten unter dem Rock hervor. Der berühmte Karikaturist James Gillray veranschaulichte, wie aufschlussreich die Kleider in der Regency-Zeit waren, selbst wenn Unterröcke getragen wurden.
Byron war nicht nur ein beliebter Autor, sondern ebenso ein berüchtigter Frauenliebling, der die Gunst der Frauen großzügig nutzte. Seine Affaire mit Caroline Lamb war ein Gesprächsthema der oberen Gesellschaft. Das soll nicht heißen, dass es keine anderen Frauen gab, sondern dass Frau Lamb Ehefrau eines angesehenen Aristokraten und Politikers war. Nachdem ihm 1816, neben dem übermäßigen Alkohol- und Drogenkonsum, ausschweifende Sexualpraktiken vorgeworfen wurden, verließ er Großbritannien. Byron, der in dieser Gesellschaft durchaus also Namen und Rang und lang genug daran teil hatte, schwor jedoch in Don Juan und seinem Leben dem Dandytum ab (mit einigen Rückfällen), so dass der Text zugleich als eine Selbsttherapie erscheint. Er habe es übertrieben, sei bereits im Sommer angelangt, während er nach Lebensjahren noch mitten im Frühling stünde. Auf Bildern zeigte Byron sich elegant, aber auch ohne das obligate modische Halstuch des Dandys. Am Ende des ersten Gesanges legte Byron dar, er folge den Prinzipien der klassischen englischen Poesie von Milton, Dryden und Pope, nicht dem Geschmack seiner romantischen Zeitgenossen, namentlich Coleridge, Wordsworth und Southey („Der Erste trinkt, dem Zweiten gehn die Schrauben im Kopfe los, der Dritt‘ ist schon verschroben“). Ruhm sei eine Illusion und als ein falsches Motiv für das Schreiben von Poesie. Es hätte keinen Sinn, in gewissen Zeitungen regelmäßig erwähnt zu werden.

Sein Sittenbild wurde — wie viele andere Satiren auch — in der anständigen Oberschicht scharf kritisiert. Byron beschwerte sich am 1. Februar 1819 in einem Brief an seinen Verleger Murray über die frühen Reaktion auf den ersten Canto: Wenn die Kritiker gesagt hätten, sein Gedicht sei schlecht, so hätte er es geduldet. Aber sie würden ihm das Gegenteil sagen und dann von der Moral sprechen. Zum ersten Mal höre er das Wort Moral von Personen, die keine Schurken seien und die das Wort mit einer bestimmten Absicht nutzten. Don Juan sei ein höchst moralisches Werk, nur, wenn die Leser die Moral nicht erkennen würden, sei dies deren Schuld, nicht die seinige.
Nach der Veröffentlichung und im Laufe der nächsten fünf Jahre — also praktisch bis zu seinem Tod — kämpfte Byron mit Zensur. 1819 wurde nicht nur in Deutschland die Zensur verschärft, sondern ebenfalls in Frankreich und Großbritannien (Six Acts). Byron, der sich in diesen Jahren allerdings in Italien aufhielt, wurde wegen Unsittlichkeit angeklagt.

Don Juan (Cantos) kam 1819 als Quartausgabe, je nach Qualität der Bindung, für 35 bis 40 Schilling (s.) auf den Markt — und es wurde nachgedruckt, „pirated“, wie man es schon damals nannte. Schuld war — nach Meinung von Lord Byron — sein Verleger Murray höchstpersönlich, weil er die ersten beiden Cantos nur als Quartausgabe für anderthalb Guineen auf den Markt gebracht habe (damals durchaus üblich), obwohl eine hohe Nachfrage bestand. Weil das Werk als pornographisch eingestuft wurde, verweigerte allerdings der Lordkanzler (Court of Chancery) den Erlass einer Verfügung gegen Nachdrucker. Unmoralische Werke würden vom Gesetz nicht geschützt werden. Der u. a. für die Zensur zuständige Lord Chamberlain hatte 1817 verfügt, dass unmoralische, volksverhetzende oder blasphemische Schriften nicht in den Genuss des Copyrights kommen sollten.
Das Bild zeigt deshalb eine für Großbritannien außergewöhnliche Entwicklung: In der Regel wurden Bücher nur als teure Quart- oder Oktavausgaben in kleinen Auflagen von 500 oder 750 Exemplaren auf den Markt gebracht. Weil jedoch der Lordkanzler die Nachdrucke nicht verbot, kamen immer kleinere und billigere Ausgaben auf den Markt.

Dem sittlichen Zweck wäre wohl eher durch das Copyright gedient worden, denn zahlreiche Nachdrucke machten das pornographische Machwerk zum bei weitem auflagenstärksten Werk moderner Literatur dieser Zeit. Ein halbes Dutzend der Nachdrucke lässt sich heute nur noch anhand eines einzigen archivierten Druckexemplars feststellen und es lässt sich kaum sagen, ob innerhalb einiger Jahre einhundert- oder zweihundertausend Exemplare gedruckt wurden (St Clair: The Reading Nation in the Romantic Period).
Der Verleger von Lord Byron, John Murray II, jammert nach dem Erscheinen der ersten Nachdrucke wie es sich für einen ordentlichen Kaufmann gehört: Er würde verarmen. Aber für die weiteren Cantos zahlte der tatsächlich überaus vermögende Verleger seinem Bestsellerautor dennoch stattliche Honorare, auch wenn diese ebenfalls nachgedruckt wurden.
Mehr Erfolg mit der mittelbaren Zensur hätte das Gericht wohl gehabt, wenn sie das Copyright durchgesetzt hätte, denn dann hätte der Absatz selbst eines beliebten Werks beim Preis von 35 Schilling bei einer Auflage von wenigen Tausenden gestockt. Nachdrucke für zwei Schilling und sechs Pence hätte es nicht gegeben. In Großbritannien hatte man durchaus Erfahrung mit der mittelbaren Zensur über den Preis. Indem Zeitungen mit einer Steuer belegt wurden und die Steuern in kritischen Zeiten erhöhte (etwa nach der französischen Revolution oder auch 1819), bewahrte man die Unterschicht vor der überflüssigen Aufklärung.
Vergleiche hierzu auch: Geschichte und Wesen des Urheberrechts














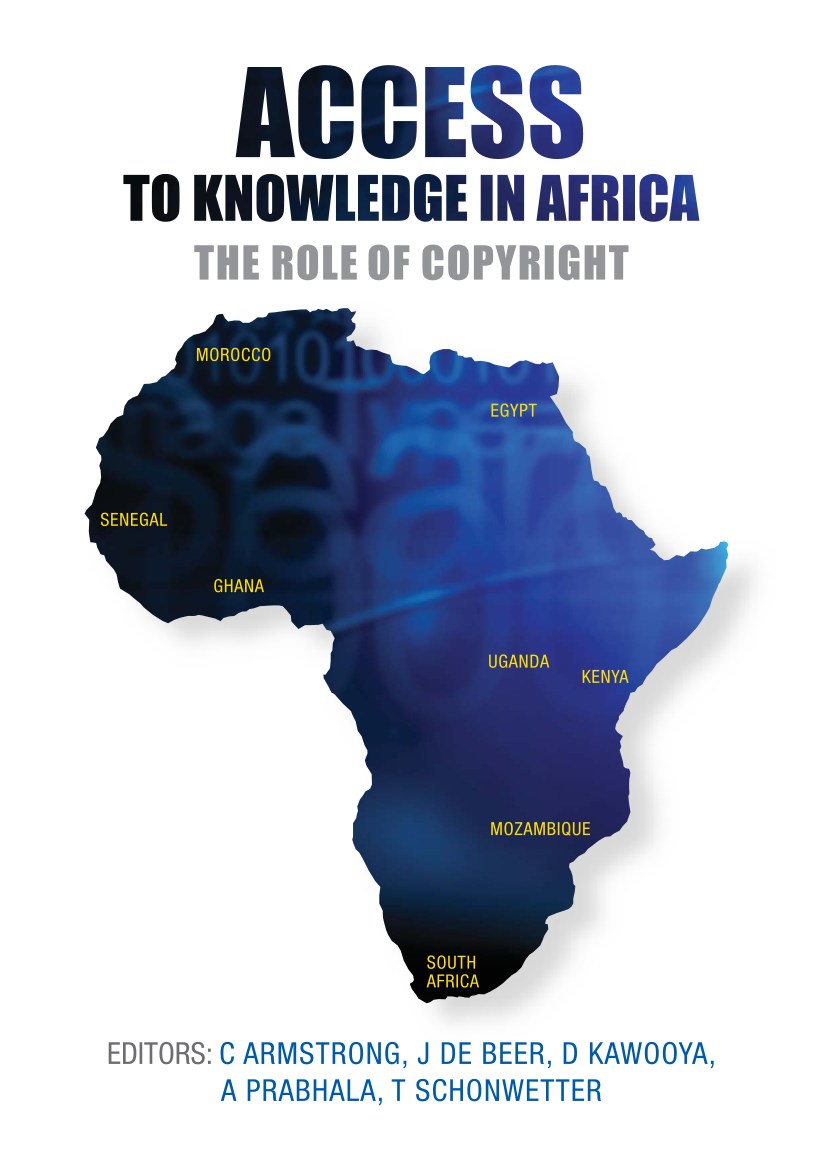






 Ein weiterer Aspekt ist die bestehende Aufsplitterung der Interessen der Leser, die sich in dem Medium Zeitung nicht spiegelt. In der klassischen Zeitung findet man Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft oder etwa Regionales. Die meisten Leser interessieren sich nur für einen Teil der in einem Medium vereinigten Themen. Das Internet erlaubt eine Spezialisierung, die es der alten Methode, viele Interessen unter einem Dach zu vereinigen, schwer macht. Durch das Internet sind die Möglichkeiten der Leser, ihre eigene Bewertung durch Annahme oder Ablehnung des jeweiligen Angebots zum Ausdruck zu bringen, größer geworden. Die Leser haben an Macht hinzugewonnen. Erst dies erlaubt einen Wettbewerb, der nach unterschiedlichen Kriterien unterscheiden kann. Man kann auf Masse achten, man kann auf hochwertige Beiträge setzten, man kann aber nicht einfach die Zeitung ins Netz stellen.
Ein weiterer Aspekt ist die bestehende Aufsplitterung der Interessen der Leser, die sich in dem Medium Zeitung nicht spiegelt. In der klassischen Zeitung findet man Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft oder etwa Regionales. Die meisten Leser interessieren sich nur für einen Teil der in einem Medium vereinigten Themen. Das Internet erlaubt eine Spezialisierung, die es der alten Methode, viele Interessen unter einem Dach zu vereinigen, schwer macht. Durch das Internet sind die Möglichkeiten der Leser, ihre eigene Bewertung durch Annahme oder Ablehnung des jeweiligen Angebots zum Ausdruck zu bringen, größer geworden. Die Leser haben an Macht hinzugewonnen. Erst dies erlaubt einen Wettbewerb, der nach unterschiedlichen Kriterien unterscheiden kann. Man kann auf Masse achten, man kann auf hochwertige Beiträge setzten, man kann aber nicht einfach die Zeitung ins Netz stellen.